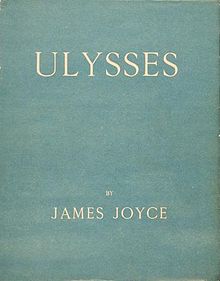Schriftsteller im Netz des Ausländerrechts – Rainer Maria Rilke und Hans Mayer in der Schweiz
I. Der halblegale Aufenthalt als „Duldung“
Goethe schreibt in den »Maximen und Reflexionen«: „Toleranz muß zur Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen“.[1]
Er meinte damit nicht den spezifisch-neuzeitlichen Begriff des „Aufenthaltstitels“ Duldung. Das mit der Entstehung von Nationalstaaten einhergehende Aufenthalts- oder Ausländerrecht war zu seiner Zeit noch kaum entwickelt: Und doch passt dieser Begriff exakt für diesen „Titel“, wenngleich er unter diesem Aspekt von der Literaturwissenschaft bis heute kaum untersucht wurde.
Bisweilen jedoch sollten jedoch Literaturwissenschaftler bei der Analyse der Biografie von Autoren Vertretern anderer Fachrichtungen den Vortritt lassen, ja vielleicht sogar deren Erkenntnisse zum Anlass eigener Untersuchungen nehmen. Dies gilt vor allem dann, wenn Umstände im Leben eines Autors mit literaturwissenschaftlichen Mitteln weder geklärt noch auf ihre Bedeutung für dessen Werk untersucht werden können.
Im Gegenteil: Dem Nur–Literaturwissenschaftler bleiben manche Umstände im Leben des Autors bisweilen gänzlich verborgen oder werden von ihnen in ihrer Bedeutung für das Werk des Autors nicht erkannt.
Mir fiel dies aufgrund eigener jahrelanger Erfahrungen als „Ausländeranwalt“ bei der kritischen Analyse der Biografien Rainer Maria Rilkes und des Literaturwissenschaftlers (!) und Autors Hans Mayer auf. Beide hatten – wenn auch zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlicher Intensität – Begegnungen mit einem illegalen oder – schlimmer noch – halblegalen Aufenthalt. Und zwar in Gestalt einer behördlichen Willkür freien Lauf lassenden „Duldung“. In ihrem Fall in der Schweiz. Diese „Duldungen“ hatten – wie bei allen Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben – zweifellos gravierende Folgen für ihr Leben, für ihr Sicherheitsempfinden, für ihre Arbeit. Dabei war und ist es vor allem das Gefühl des Ausgeliefert-Seins an die Willkür einer unberechenbaren Behörde und der schwierige Kampf um die Sicherung des Aufenthaltes, die ihre Lage kennzeichnete.
Das was man als „illegalen Aufenthalt“ bezeichnet, ist für den Betroffenen nicht nur von fundamentaler existenzieller Bedeutung. Es ist gleichzeitig – trotz aller Unterschiedlichkeit der jeweiligen Rechtsordnungen – zu nahe zu allen Zeiten ein gleichbleibendes Phänomen: Es fängt an bei der illegalen Einreise in ein Land, die auf zweifacher Weise vorkommen kann: Die Einreise ohne Pass oder die Einreise ohne Visum. Es geht weiter zum illegalen Aufenthalt der – solange der Betroffene nicht abgeschoben wird oder abgeschoben werden kann – übergeht in den unsicheren Status der bloßen Duldung.
Geändert hat sich dies nach 1945 nur durch das Recht der politischen Flüchtlinge, das aufgrund der Erfahrungen politisch Verfolgter im Exil einen scheinbaren sicheren Status erfuhr. Doch wurde das Asylrecht bekanntlich nicht nur in Deutschland weitgehend zurückgeschraubt, auch die Struktur und die Funktionsweise des Aufenthaltsrechts stammt immer noch aus der Zeit von vor 1945.
II. Die Duldung des Juden und „Roten Kämpfers“ Hans Mayer
Im Gegenteil: In manchen Bereichen werden das Aufenthaltsrecht und das Grenzregime noch strikter gehandhabt als dies zuvor der Fall war: Ohne Pass und ohne gültige Papiere reiste der politisch Verfolgte Hans Mayer 1933 über Belgien und Luxemburg nach Strasbourg.[2] In Belgien fragte ihn niemand im Hotel nach seinen Papieren.[3] Der Deutsch-Schweizer Dr. Leo Jenni brachte ihn ohne Pass und Visum von Frankreich nach Genf, bevor er im Laufe der folgenden Jahre mehrfach ohne jede Kontrolle „die Grenze im Jura und Savoyen“[4] überschritt.
Hingegen war die aktuelle Lage an der deutschen Grenze noch v o r der Flüchtlingswelle 2015 und auch vor Corona gekennzeichnet von der „Unsichtbarkeit“ der Grenzorgane bei ihrer gleichzeitigen Effektivität. Ich erinnere mich, wie ich etwa um das Jahr 2000 mit dem Fahrrad bei Højer in Dänemark auf dem Deich ein unbemanntes Grenzhäuschen passierte und in exakt in dem Moment des Grenzübertritts ein unter einer Linde versteckter Pkw der Bundespolizei auf den Deich schoss, um mich zu kontrollieren. Ich war deutscher Staatsangehöriger und „reiste“ mit deutschem Pass nach Deutschland ein…
Die Legenden um den Wegfall von Grenzen und die Liberalisierung des Aufenthaltsregimes halten sich hartnäckig. Doch sie sind nur bei denen verbreitet, die das tatsächliche Ausländerrecht und die Realität der Passlosigkeit nicht kennen. Dies gilt z. B. für die mir als Anwalt immer wieder begegnete Bestrafung des passlosen, abgelehnten Asylbewerbers. Darunter waren und sind Ausländer, deren „Duldung“ 30 Jahre lang (!) alle 3 Monate verlängert wurden und die zigmal zum Konsulat ihres Heimatlandes geschickt wurden, um sich Ersatzpapiere ausstellen zu lassen, aber die Papiere nicht bekamen und dann wieder „zu Straftätern“ wurden (wobei natürlich dem „Geduldeten“ jegliche Arbeitsaufnahme verwehrt wurde…).
Was dieses und Ähnliches für einen freien Autor bedeutet oder bedeuten kann, lässt sich unschwer erahnen. Als Hans Mayer schließlich 1938 freier Mitarbeiter der Zeitschrift „Tat“ in Zürich wurde, war ihm „jegliche Tätigkeit gegen Entgelt …“ streng untersagt.[5]
Zu der sozialen und ökonomischen Unsicherheit kommt beim „Geduldeten“ die Unsicherheit der formellen Existenz, die Ungewissheit des Aufenthaltsstatus, der grundsätzlich jederzeit zur Abschiebung in das Heimatland oder in ein anderes Land führen kann. Nachdem die Illegalität Hans Mayers den Schweizer Behörden schließlich 1939 bekannt wurde, wurde er nach Frankreich „ausgeschafft“.[6] Am Vorabend des 2. Weltkrieges war die Grenze nach Frankreich bereits geschlossen und er konnte und durfte die Grenze nur deshalb nicht übertreten. Durch die Intervention eines Genfer Staatsrats wurde schließlich die Ausweisung zurückgenommen.[7]
Doch das schützte ihn vor der Internierung in einem „Arbeitslager für Emigranten“ nicht. 1942 ging an alle Grenzstellen in der Schweiz die Weisung, Flüchtlinge an der Grenze abzuweisen und alle, die die Grenze illegal überschritten hatten, wieder „zurückzustellen“.[8] Das aber bedeutete für die Betroffenen den sicheren Tod. Hans Mayer war politisch Verfolgter und er war a u c h Jude. Als Emigrant, der v o r dieser Maßnahme die Schweiz betreten hatte, war er nicht ganz papierlos. Das schützte ihn einstweilen. Doch sicher konnte er auch dadurch nicht sein.
In dieser Lage erlahmten all jene Kräfte, die zum Schreiben erforderlich waren. Er sagte später über diese Zeit: „Ich ließ mich hinleben.“[9] Er glaubte an eine noch vor ihm liegende Zukunft. Er war noch jung und gesund. Und als Hauptgrund für seine (scheinbare) Indifferenz gegenüber dem Migrantenschicksal erkannte er, „dass ich kein Heimweh hatte“.[10] Er musste also „nur“ warten. Und er wartete. Aber Warten ist keine Arbeit. Und auch nicht die Arbeit eines Autors.
Es sei daran erinnert, dass diese Ungewissheit und dieses unproduktive Warten auf etwas, das noch kommt, entgegen allen anderslautenden Gerüchten auch heute noch vorkommt. Wer ohne Dauervisum in die Bundesrepublik Deutschland einreist, kann keinen Daueraufenthalt begründen. Wer als Tourist kommt, muss auch als Tourist gehen und darf nicht einwandern. Und wessen Pass ungültig ist, kann gar keinen Aufenthalt bekommen und ihn auch nicht verlängern lassen. Pass – Visum – Aufenthalt; das sind die wesentlichen Elemente dieses Systems. Sie hängen alle miteinander zusammen. Dazwischen steht die Ungewissheit des Aufenthalts als bloße Duldung. Ein Zustand dauerhafter Ungewissheit. Ein Zustand des ungewissen Wartens.
Wie oft fragen wir einen im Exil lebenden Autor nach „seinem“ Status? Er ist uns unbekannt. Es kann ein sicherer sein. Aber auch ein völlig ungewisser. Offenbar geht dieser Status nur ihn – den Exilanten – etwas an. Wir jedenfalls fragen nicht danach.
III. Flucht und Duldung Rainer Maria Rilkes
Rainer Maria Rilke verließ Deutschland am 11.06.1919. Es ist unklar, ob dies auch subjektiv ein endgültiger Abschied (aus München) war und ob er letztlich politisch motiviert war. Rilke hat sich dazu später gegenüber Ernst Toller wie folgt geäußert:
„Ich bin auch nicht aus München vertrieben worden, wo ich mich 1919 aufhielt. Eine Hausdurchsuchung war die einzige mir dort bereitete Unannehmlichkeit. Aber man zwang mich nicht, die Stadt zu verlassen. Ich folgte einer Einladung in die Schweiz.“[11]
Doch was will das heißen? Auch Hans Mayer „zwang man nicht, Deutschland zu verlassen. Er hatte noch am 04.07.1933 die große juristische Staatsprüfung im Preußischen Justizministerium abgelegt, und zwar mit einem Beisitzer namens Roland Freißler.[12] Aber er ahnte natürlich, was auf ihn zukommen würde, denn er bezeichnete sich gern und offen als „Roter Kämpfer“[13] und er war bei aller Intellektualität ein durch und durch politischer Mensch.
Anders als Rilke, der erst kurz vor der Novemberrevolution vor 1918 „begann … linke Positionen zu unterstützen“[14]. Seiner Frau Clara Westhoff schrieb er zwar, dass man nicht anders als zugeben könne, „dass die Zeit Recht hat, wenn sie große Schritte zu machen versucht.“[15] Und eröffnete seine Atelierwohnung in der Ainmillerstraße in München auch für inoffizielle Treffen revolutionärer Schriftsteller, zu denen Ernst Toller gehörte.[16] Er kannte Kurt Eisner und korrespondierte mit diesem. Doch bekannte er seine Überzeugungen keineswegs gegenüber allen Freunden. Vor allem gegenüber dem Verlegerehepaar Kippenberg zeigte er sich verschlossen und hielt sich mit seiner politischen Meinung zurück.[17]
Vorbereitungen für eine Vortragsreise in die Schweiz hatte er auf Drängen Kippenbergs getroffen.[18] Aber der Abreise selbst war nicht – wie Rilke später gegenüber Toller bekannte – e i n e Hausdurchsuchung vorausgegangen, sondern zwei! Daraufhin hatte er es abgelehnt, Toller bei sich zu verstecken. Er wusste, dass man ihn „auf dem Zettel“ hatte.
Die Entscheidung, Deutschland zu verlassen, musste auch aus einem anderen Grund endgültig gewesen sein, denn bei seiner Rückkehr wäre der aus Prag stammende Rilke als „Ausländer“ ausgewiesen worden oder gar nicht erst ins Land gelassen worden. Er hatte sich nicht nur politisch verdächtig gemacht, sondern er galt auch wegen des Endes der österreich-ungarischen Monarchie als staatenlos. Damit hätte er nie die Grenze zu Deutschland überqueren können. Später erhielt er einen tschechoslowakischen Pass, betrat aber nie tschechoslowakischen Boden. Auch nicht seine Heimatstadt Prag. Mit dem Pass verbesserte sich zwar der Status Rilkes, aber gleichzeitig verschlechterte er sich auch. Denn er konnte nun in die Tschechoslowakei abgeschoben werden, was er unter allen Umständen vermeiden wollte.
Stattdessen begann eine komplizierte Odyssee durch die Gefilde des Schweizer Fremdenrechts. Der Aufenthalt war zunächst nur für 10 Tage (!) bewilligt worden.[19] Doch schon in einem Brief vom 14.05.1919 an den Organisator seiner Vortragsreise, den Schweizer Dr. Hans Bodmer, drängte er darauf, „dass ein längerer Aufenthalt bewilligt wird oder doch Verlängerungsmöglichkeit gegeben ist“.[20] Ein weiterer Hinweis für die Absicht eines Daueraufenthaltes in der Schweiz und eines dauerhaften Verlassens Deutschlands. In einem weiteren Brief an Dr. Bodmer vom 16.06.1919 äußerte er die Idee nach genauer Überlegung, „die Verlängerung meines Aufenthaltes in der Schweiz durch ein ärztliches Attest zu bewirken“.[21] Damit er sich damit nicht zu dem Zweck seiner Reise (Vorträge) in einen Gegensatz setzen würde, schlug er vor, gegenüber der Behörde geltend zu machen, er sei genötigt, seine Vorlesungen „zunächst wegen schlechter Gesundheit aufzuschieben“.[22] Er schließt: „Hoffen wir, dass Bern sich geneigt erweist“.[23] Er hing an einem seidenen Faden. Er machte sich abhängig von der ihm zu attestierenden Krankheit, der Möglichkeit, die Vorträge zu verschieben, u n d einer „geneigten“ Fremdenpolizei. Und dies war und ist keineswegs etwas Untypisches für Menschen, die sich im Status der Halblegalität befinden. Sehr oft wird die Krankheit als Aufenthaltsgrund aufgeführt. Das ist auch heute noch so. Die Krankheit als Argument ist aber ein zweischneidiges Schwert. Einerseits bedeutet die eigentlich angestrebte Genesung den Wegfall des Aufenthaltes nach ihrem Eintritt, andererseits kann die Krankheit eben deshalb nie ein Argument für einen dauerhaften Aufenthalt sein. Und tatsächlich dient das Argument teils nur einem gewissen Zeitgewinn, wobei jederzeit die Gefahr besteht, dass die Fremdenpolizei oder Ausländerbehörde eine dauerhafte Erkrankung des Betroffenen zum Anlass nimmt, den Aufenthalt ganz abzulehnen und bei „Transportfähigkeit“ sogar eine Abschiebung vornimmt.
Um die behördliche Willkür, von der er ja letztlich abhing, zu minimieren, schaltete Rilke eine Reihe von Freunden ein, die über Beziehungen zu den Behörden verfügten. Nach Dr. Bodmer war dies vor allem Hanns Buchli. Diesem schreibt er ein Jahr später, er sei in die Schweiz gekommen mit einer Bewilligung für nur 10 Tage und diese sei „mittels ärztlichem Attest“ dreimal für je 3 Monate verlängert worden.[24] Aus der Vortragsreise von 10 Tagen war also ein Aufenthalt mittels Krankheit von 9 Monaten geworden. Aber das erscheint, wenn es so dahingesagt wird, viel leichter als es getan war und irgendwann würde auch diese „Lösung“ erschöpft sein. Das wusste Rilke nur zu genau. Am 07.04.1920 schreibt er an Hanns Buchli:
„Tun Sie … bitte für mich keine weiteren Schritte. Ich versuch es, mich mit diesen Aussichten auszusöhnen … Jede Möglichkeit …, die ich den Verhältnissen der Schweiz jetzt noch abringen vermöchte, wäre doch am Ende nur ein Provisorium“.[25] Doch dann schreibt er nur knapp 3 Wochen später an Buchli, er läge doch Wert darauf, „noch bleiben zu dürfen“.[26] Zwei Gründe nennt er: Eine Verschlechterung seines Gesundheitszustandes und die Ausweisung aller nach dem 01. August 1914 zugezogenen Ausländer in München.
N u n wird die Verschlechterung der Gesundheit zum Verlängerungsgrund. Mehr als Hoffnungen kann er an diese Argumentation nicht knüpfen und bezeichnender Weise schreibt er an Buchli: „Vielleicht kommen Sie in die Lage, dieses bei den Behörden in ein rechtes Licht zu setzen.“[27]
Plötzlich tritt eine Besserung seines Zustandes ein und er erkennt sofort den Widerspruch zu dem von ihm genannten Aufenthaltsgrund [28] Dieses Mal verzichtet er aber auf ein Attest und hebt den geplanten Besuch „Baseler Bibliotheken und Sammlungen“ hervor. Er endet mit dem Satz: „Hoffen wir also.[29] Schließlich erhält er eine Aufenthaltsbewilligung. Die Schweiz und vor allem das Walis wird ihm zur letzten Heimat. Im Turm von Muzot vollendet er seine Duineser Elegien.
IV. Krankheit und Duldung
Hans Mayer schreibt über eine Reise im März 1943 in das Wallis: „Da lag das Türmchen von Muzot, wo Rilke gewohnt hatte, aber man wurde nicht eingelassen. Dorthin durften nur richtige Dichter.“[30] Er war noch kein „richtiger“ Literat und er empfand sich auch nicht so. Rilke hingegen war schon Legende. Er vollendete sein Werk in der Schweiz so gut es eben ging. Als die letzte Elegie fertig war, verschlimmerte sich sein Leiden. 1926 verstarb er nach schwerer Krankheit. Die Krankheit begleitete ihn auch in seinem Ringen um einen legalen Aufenthalt in der Schweiz. Es kann kaum geleugnet werden, dass die positive Rolle einer „Verschlimmerung“ seiner Krankheit im Zusammenhang mit der Verlängerung seines Aufenthaltes Auswirkungen auf seine Psyche gehabt haben muss. Nur Mediziner können die Frage beantworten, ob diese „positive Rolle“ auch den Krankheitsverlauf selbst beeinflusst hat. Wer seinen Aufenthalt und damit einen Teil seines Lebensglücks an eine schwere Krankheit kettet, begibt sich in kaum beherrschbare Gefahren. Doch dies war alles andere als ein Rilkescher Charakterzug, es waren vielmehr die Zwänge des zu allen Zeiten inhumanen Aufenthaltsrechts, denen er auf andere Weise nicht Herr zu werden vermochte. Hans Mayer hingegen befand sich vom Zeitpunkt seiner Internierung an in einer eher passiven Rolle. Er ließ sich „dahinleben“ und wartete, wenn auch in ständiger Angst, auf bessere Zeiten. Die kamen dann auch für ihn. Er war in der Schweiz der Hölle des Nazi-Terrors entronnen und mit dem Ende dieses Terrors brach für ihn eine neue Zeit an. Rilke befand sich in einer vergleichsweisen komfortablen Lage auf seinem Turm von Muzot, aber er hatte, nachdem sein Aufenthalt gesichert war, den Tod vor Augen. Beider Leben wären mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit anders verlaufen, wenn ihre Existenz nicht über Jahre hinweg von der Willkür des Aufenthaltsrechts gekennzeichnet gewesen wäre.
Goethe hatte –ohne zu wissen – Recht gegenüber dem ihm noch unbekannten „Ausländerrecht“. Toleranz muß zur Anerkennung führen, d.h. zum R e c h t auf Aufenthalt. Ohne dieses Recht ist der A u s länder nicht „anerkannt“. Duldung ist kein Recht, sondern blosse Willkür, die nicht nur den freien Autor seiner eigentlichen Freiheit beraubt. Duldung verdunkelt die freie Sicht auf das was geschrieben werden soll und geschrieben werden kann.
Rolf Geffken
* Dr. Rolf Gefken, ist ein deutscher Rechtsanwalt für Arbeitsrecht, Autor und Verleger, Dozent, China- und Schifffahrtsexperte. Er stand einige Jahre vor Hans Mayers Tod mit diesem in Verbindung. Das beide beschäftigende Thema war das (juristische) Problem der „Grenze“ und die damit verbundenen Arbeits- und Lebensbedingungen.
Wir freuen uns sehr, dass Dr. Geffken seinen Beitrag für die Veröffentlichung zum »Tag der Menschenrechte« dem 10. Dezember zur Verfügung gestellt hat.
[1] Goethe, Maximen und Reflexionen Nr. 151, in: Goethe, Hamburger Ausgabe, Band 12, 12. Auflage München 1982, S. 385
[2] Mayer, Ein Deutscher auf Widerruf – Erinnerungen, Band 1, Frankfurt 1988, S. 164
[3] A.a.O., S. 167
[4] A.a.O., S. 193
[5] A.a.O., S. 229
[6] A.a.O., S. 256
[7] A.a.O., S. 257
[8] A.a.O., S. 261
[9] A.a.O., S. 190
[10] Ebd.
[11] Schnack, Rilke – Chronik seines Lebens und Werkes, 2. Auflage 1996, S. 639
[12] Mayer, a.a.O., S. 126
[13] A.a.O., S. 122 ff.
[14] Freedman, Rainer Maria Rilke – Der Meister 1906 – 1926, Frankfurt 2002, S. 276
[15] Brief an Clara Rilke-Westhoff, 7.11.1918, zit.n. Freedman, Band 2, S. 279
[16] Freedman a.a.O., S. 280
[17] A.a.O., S. 277
[18] A.a.O., S. 278
[19] Schnack, a.a.O., S. 643
[20] Rainer Maria Rilke, Briefe an Schweizer Freunde (Hrsg. Rätus Luck), Frankfurt 1990, S.15
[21] Ebd.
[22] A.a.O., S. 16
[23] Ebd.
[24] A.a.O., S. 50
[25] A.a.O., S. 56
[26] A.a.O., S. 61
[27] A.a.O., S. 63
[28] A.a.O., S. 68
[29] A.a.O., S. 70
[30] Mayer, a.a.O., S. 287