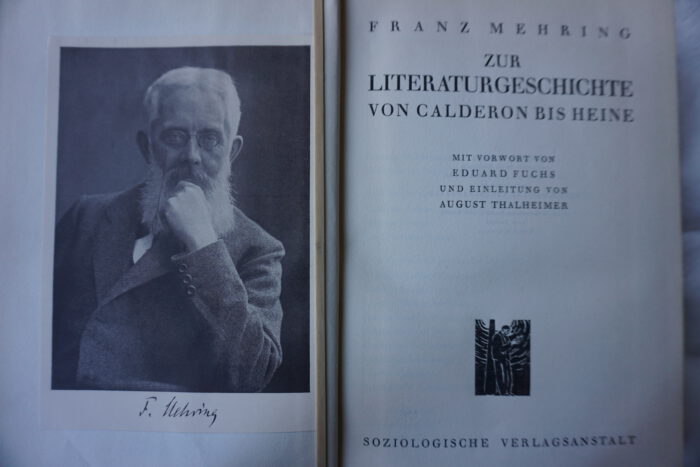Hans Mayer und Georg Lukács – Eine kritisch-respektvolle Beziehung
Mit Datum vom 7. Juni 1957 ging bei dem „Lieben Kollegen Mayer“ ein Brief mit folgendem Wortlaut ein: „Entschuldigen Sie, dass ich mich mit einer Bitte an Sie wende. Seit früher Jugend sind mir die folgenden Zeilen im Gedächtnis geblieben: Meister Arouet sagt: Ich weine / Und Shakespeare weint. Ich habe immer geglaubt, dass diese Zeilen von Mathias Claudius sind. Als ich sie aber unlängst irgendwo zitieren musste, habe ich die Stelle bei Claudius nicht gefunden. Hier konnte ich nicht erfahren, von wem sie stammen, wenn mich mein Gedächtnis wirklich getäuscht hatte. Für Sie ist es sicher eine Kleinigkeit, mich darin aufzuklären.
Im voraus herzlichen Dank. Bitte grüßen Sie meine Leipziger Freunde herzlichst
Ihr ergebener Georg Lukács.“[1]
Der nach der Niederschlagung des ungarischen Aufstandes von 1956 in der Sowjetunion, Ungarn und der DDR verfemte Kulturminister aus der Regierung des zum Tode verurteilten und 1958 hingerichteten ungarischen Ministerpräsidenten Imre Nagy[2] wusste, dass er sich mit seiner Anfrage an den Richtigen wandte. Für den jungen Studenten Hans Mayer war der Autor des 1923 erschienen Buches »Geschichte und Klassenbewußtsein. Studien zur marxistischen Dialektik« einer seiner wichtigsten Lehrer.[3] In seinen »Erinnerungen« schreibt er: „Der gelb broschierte Band aus dem Malik Verlag hat in meinem Leben eine beträchtliche Rolle gespielt. Bei der ersten Emigration konnte ich ihn noch mitnehmen, verlor ihn dann, er war auch nicht zu ersetzen, denn der Autor Lukács verleugnete sein Buch, wollte es nicht wieder publizieren, gab den Neudruck erst im Jahre 1968 für die Gesamtausgabe frei.“[4]
Um 1930 veranstalteten die Philosophen Helmuth Plessner, Erwin von Beckrath und Alfred Müller (-Armack) an der Universität Köln ein Marxismus-Seminar. Der erste Referent war Hans Mayer mit dem Thema „Was ist orthodoxer Marxismus?“ Das entsprach dem gleichlautenden ersten Kapitel des Lukács-Buches. Zum Ende des Vortrages meinte Plessner etwas belustigt aber auch nachdenklich: „Wenn man das akzeptiere, was soeben vorgetragen wurde, so laute die Folgerung, daß man orthodoxer Hegelianer sein müsse, um orthodoxer Marxist zu werden.“[5]

Lukács‘ Buch und Anderson Nexös »Pelle der Eroberer« bewirkten, dass Hans Mayer zum „Roten Kämpfer“ wurde. Mit der Marxistischen Arbeiterzeitung »Der Rote Kämpfer«, die Mayer mit anderen Genossen ab 1930 herausgab, versuchte man die politische Debatte – insbesondere zwischen KPD und SPD – zu beeinflussen. »Geschichte und Klassenbewußtsein« war nicht nur für den jungen Hans Mayer ein „Erweckungsbuch“. 1970 erschien es als eine Sonderausgabe im Luchterhand-Verlag als Taschenbuch. Noch kostengünstiger war der in Studentenkreisen erhältliche Raubdruck des Werkes in den siebziger Jahren. In dem zur Wiederauflage geschriebenen kritisch reflektierenden Vorwort weist Lukács darauf hin, dass das Kapitel über die „Verdinglichung“ sowie die Kategorie der „Vermittlung“ zentrale Themen des Buches ausmachen. In seiner Spiegelrezension beim Wiedererscheinen des Buches stellt Hans Mayer unter dem Titel „Widerruf des Widerrufs“ fest: „Es gibt kaum eine aktuelle Diskussion über die heutigen Perspektiven von Kapitalismus und Sozialismus. bürgerlichem und marxistischem Denken falschem und richtigem Bewußtsein, Selbstentfremdung und Warencharakter des Kulturbetriebes, die nicht zuerst von Georg Lukács und diesem Buch hier angeregt worden wäre.“[6]
Natürlich hat der „Kollege Mayer“ den „Lieben, verehrten Georg Lukács“ 1957 nicht lange auf seine Antwort warten lassen. Ein am 14.6.1957 aus der Tschaikowskystraße 23 in Leipzig abgesandter Brief enthielt folgende Mitteilung: „Ihr Gedächtnis hat Sie auch diesmal nicht betrogen. Die erwähnten Zeilen sind in der Tat von Matthias Claudius. Sie stehen im “Wandsbeker Boten“ in Nr. 200 vom Jahre 1771, und zwar unter dem Titel „Vergleichung“. Sie lauten genau:
Voltaire und Shakespeare: der eine
Ist was der andere scheint.
Meister Arouet sagt: ich weine;
Und Shakespeare weint.
Auch ich halte den Vierzeiler für eine meisterhafte Prägung, weshalb ich ihn in einer Studie über „Schillers Vorreden zu den ‚Räubern‘ gleichfalls zitiert und analysiert habe. Meine Studie … habe ich dann in meinen Essayband „Deutsche Literatur und Weltliteratur“ aufgenommen, … Mit der gleichen Post schicke ich Ihnen das Buch zu und hoffe, Sie mögen aus dem Ganzen wie den Einzelheiten entnehmen, wie sehr dies alles Ihnen und Ihrem Werk verbunden ist.“[7]
In seinem Beitrag zu „Schiller Vorrede“ reflektiert Mayer das Claudius-Zitat in Bezug auf den Ausdruck von Empfindung in einer theatralischen Handlung, die eine Demonstration in vermittelter gespiegelter Form sei.[8] Vielschichtiger und dezidierter geht Lukács in seiner „Eigenart des Ästhetischen“ auf dieses Claudius-Zitat ein. Im Kapitel zum „Entstehen der ästhetischen Kategorien aus der magischen Mimesis“ schreibt er: „Da die mimetischen Gebilde vor allem Gefühle, Leidenschaften etc. zu evozieren berufen sind, muß jener, der sie direkt (im Tanz, Schauspiel) oder indirekt (Dichtung, bildende Kunst etc.) hervorrufen will, diese Gefühle und Leidenschaften denkbar intensiv erleben;…“ Kritsch reflektiert er dann im Folgenden: „Die Direktheit muß in den rezeptiven Beziehungen zu den Widerspieglungsbildern schon darum fehlen, weil die Art der Reaktion auf das vom Leben erweckte echte Gefühl eine völlig andere ist.“[9]
Für den Essayband „Deutsche Literatur und Weltliteratur“ hatte Mayer auch geplant, seinen damaligen Beitrag zum 70. Geburtstag aufzunehmen. Das Buch „Georg Lukács zum siebzigsten Geburtstag“ war 1955 im Aufbau-Verlag erschienen. In seinem Beitrag dafür hatte Mayer sehr klug über das Geburtstagskind und seine Bedeutung für die marxistische Literaturwissenschaft reflektiert. Dort heißt es unter anderem „ … wenn bestimmte literarische Fehlkonzeptionen für einen Menschen, der Lukács einmal richtig gelesen hat, nicht mehr diskutabel erscheinen, so zeigt sich daran, daß die Wissenschaft dieses ungarischen Ästhetikers, Philosophie- und Literaturhistorikers auch insoweit diesmal marxistischen Grundcharakter trug, als sie für die Wirklichkeit und die Diesseitigkeit ihres Denkens bloß das Kriterium der Praxis kennen ließ.“[10] Zwei Jahre später war dieser Beitrag für die SED aber absolut inakzeptabel. Lukács war seit dem Ungarnaufstand 1956 Persona non grata. Nicht einmal sein Name durfte mehr genannt werden.[11] Für Hans Mayer war das aber keinesfalls ein Grund, mit Georg Lukács keinen Kontakt mehr zu haben. Am Ende des Geburtstagsbeitrages schrieb er: „Ich habe Georg Lukács unendlich viel zu verdanken und weiß nicht, wo ich heute stünde, wäre ich ihm und seinem Denken nicht begegnet. Dafür möchte ich danken, und ich möchte dem verehrten Manne noch viele reiche Lebens- und Schaffensjahre wünschen.“
Er korrespondiert weiter mit ihm und sendet ihm seine Publikationen zu. Bei ihren Einschätzungen zu Brecht und E.T.A. Hoffmann sowie Kleist gibt es durchaus Differenzen. Bei Joyce und Kafka klaffen Welten. Die kontroversen Anschauungen werden z.T. in den Briefen benannt oder finden sich in einschlägigen Passagen in den Erinnerungen von Hans Mayer. Sehr konkret auch in der Publikation von Mayer über „Bertolt Brecht und die Tradition“.[12]
Im Oktober 1962 – ein Jahr vor seinem Weggang aus der DDR – konnte Mayer den verehrten Lehrer in Budapest noch einmal besuchen. „Er hatte sich wohl, nach so vielen Wandlungen und Gefahren, mit Ernst Bloch zu reden ‚zur Kenntlichkeit verändert‘. Das war ein leiser, gütiger, zuhörender, gesprächsbereiter Mann von 77 Jahren. Er kommentierte damals, die Stimme zur Vertraulichkeit dämpfend, warum er zweimal offizielle Selbstkritik übte, ohne jemals daran zu glauben. Jetzt aber sei es abgetan. Selbstkritik gleich welcher Art könne von ihm nicht mehr erhofft werden.“[13]
In der Folgezeit versäumt Mayer nicht, dem verehrten Lehrer jedes Jahr zum Geburtstag zu gratulieren. Am 30. Juni 1970 schickt er aus Hannover ein Einschreiben nach Budapest, um dem „Lieben Meister“ zur Verleihung des Frankfurter „Goethepreises“ zu gratulieren. Er hoffte, ihn zur Preisverleihung in Frankfurt wiederzusehen. Die hat aber dort nicht stattgefunden. Aus gesundheitlichen Gründen konnte Lukács nicht an der Feierstunde zur Preisverleihung teilnehmen. Am 31.8.1970 überreichte ihm daher der Oberbürgermeister Walter Möller mit einer Frankfurter Delegation, der auch Iring Fetscher als Laudator für Lukács angehörte, den Preis in Budapest. Die Auszeichnung des marxistischen Literaturästhetiker war heftig umstritten. Ablehnung gab es auch, weil Lukács ein Drittel des Preisgeldes von insgesamt 50.000 Mark dem Vietcong zur Verfügung stellte, bzw. das Preisgeld für die Aktion zur Rettung von Angela Davies erwägte.

Gut ein halbes Jahr später starb Georg Lukács am 4. Juni 1971 in Budapest. Ein Jahr später wurde in seiner Wohnung das öffentlich zugängliche Georg-Lukács-Archiv eröffnet. Nicht weit davon wurde zu seinen Ehren 1985 ein Statue aufgestellt. Doch für die rechte Orban-Regierung in Ungarn ist der Marxist und Jude Lukács ein Ärgernis. Trotz weltweiter Proteste wurde das Archiv 2016 geschlossen und ausgelagert. Die Statue im Szent-István-Park wurde laut Beschluss des Budapester Stadtrates auf Antrag der rechtsradikalen Jobbik-Partei 2017 entfernt.
Doch es gibt auch Zeichen der Hoffnung.
In Brasilien ist jüngst das Lukács-Buch »Die Zerstörung der Vernunft« veröffentlicht worden und die Debatte um seine Inhalte befördert dort Aufschlüsse über die ideologischen Inhalte der aktuellen politischen Entwicklung dort. Außerdem gibt es eine zweite Lukacs-Renaissance in China. Weitere Informationen finden sich auch über neue Publikationen in Deutschland auf der Seite der Internationalen Lukács-Gesellschaft. Ein bei Suhrkamp erschienenes neues Buch mit ausgewählten Texten zur Ästhetik, Marxismus und Ontologie gibt einen guten Einblick in die immer noch lesenswerten Texte von Lukács.
[1] Zitiert nach dem Typoskript MTA Budapest Lukács Archiv.
[2] Siehe Dalos, György: „Der Prozess gegen Imre Nagy, Ungarn 1956–1958“, in: Groenewold/ Ignor / Koch (Hrsg.), Lexikon der Politischen Strafprozesse, https://www.lexikon-der-politischen-strafprozesse.de/glossar/nagy-imre/, letzter Zugriff am 4.06.2021.
[3] Siehe Hans Mayer, Einige meiner Lehrer, Die Zeit, Nr. 13/1977 vom 5. März.
[4] Hans Mayer, Ein Deutscher auf Widerruf- Erinnerungen, Frankfurt am Main 1982, S. 96.
[5] A.a.O., S. 105.
[6] Der Spiegel 36/1970 vom 30.08.1970, S. 127.
[7] Zitiert nach dem Typoskript MTA Budapest Lukács Archiv. Abgedruckt in: Hans Mayer, Briefe 1948-1963, herausgegeben und kommentiert von Mark Lehmstedt, Leipzig 2006, S. 330.
[8] Siehe: Hans Mayer, Deutsche Literatur und Weltliteratur. Reden und Aufsätze, Berlin 1957, S. 420.
[9] Georg Lukács, Die Eigenart des Ästhetischen Band 1, Berlin und Weimar 1981, S. 404.
[10] Georg Lukács zum siebzigsten Geburtstag, Berlin 1955, S. 168.
[11] Siehe dazu auch die Erläuterungen Lehmkuhls zum Brief Mayers an Johannes R. Becher vom 25. März 1957, in: Hans Mayer, Briefe 1948-1963, herausgegeben und kommentiert von Mark Lehmstedt, Leipzig 2006, S. 323.
[12] Hans Mayer, Bertolt Brecht und die Tradition, Pfullingen 1961.
[13] Hans Mayer, Einige meiner Lehrer, Die Zeit, Nr. 13/1977 vom 5. März.