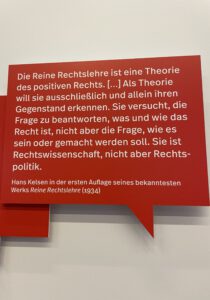Zum Geburtstag Hans Mayers veröffentlichen wir einen Beitrag von Pieke Biermann[1], die zu Hans Mayers Zeit in Hannover bei ihm gearbeitet hat und ihn persönlich gut kannte. Für ihn war sie die „Lilo“. Bei einer Lesung, die Hans Mayer am 26. Juni 1984 in der Autoren-buchhandlung machte, war sie anwesend und hat ihn auch einen Tag später nochmals zum Frühstück getroffen. In Erinnerung daran entstand das nachstehende „Fragment“. Wir danken Pieke Biermann ganz herzlich dafür, dass sie es zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt hat.
Als Anke und Helma ihm das Raum-Mikro zurechtrücken, wird es ihm zu eng. „Habt Ihr denn hier keinen Techniker, der sich auskennt?“ fragt er und weiß nicht, was er da sagt. Und, um über das, was er nicht weiß, keinen Zweifel aufkommen zu lassen, weiter: „Wo ist denn der Mann vom RIAS?“
Erst dem glaubt er, daß dieses Mikro wirklich dicht bei einem sein muß.
Er hat dieselbe Diktion und Gestik wie vor über zehn Jahren, als ich ihn zuletzt an der Universität sah. Er wirkt sogar jünger heute als damals. Ich bin in Versuchung, in meinem Kopf das Kompliment: „Sie haben sich ja überhaupt nicht verändert!“ zu formulieren und denke – „linientreu“ – sofort: „Oh!“ und erbleiche. Innerlich.
Auch die Hände und vor allem die Finger hält und bewegt er wie früher. Verschluckt Endungen auf die gewohnte Art. Ist wie immer imstande, längste und komplizierteste Satzschachteln ohne Reibungsverluste ineinanderzutürmen. Sein Gedächtnis ist glänzend; da, wo er es braucht.
Später, im „kleinen Kreis“ der illustren Namen (Irina und Stephan Hermlin, Roland Wiegenstein, der fast taube Ossip Flechtheim), wird er kurz und endgültig anmerken, er habe, als er über Chemnitz las, den Satz weggelassen, daß Hermlin da geboren ist. Es wäre „läppisch“ gewesen. Hermlin nickt dankbar, weil blamiert.
Getroffen hatte ich ihn gegen alle Inszenierungsversuche, kurz bevor er die AUTOREN-BUCHHANDLUNG betrat. Auf seinem Weg in eine Kneipe, um noch rasch einen Schluck zu trinken. „Pieke“, nein, das gehe nicht. Ich sei „Lilo“. Gut, sage ich, damit kann ich leben. „Sie dürfen weiter Lilo sagen.“ „Man sieht sich ja noch!“
Manche wundern sich, hinterher in der Kneipe ohne ihn, über Hermlins Oberschüler-Pose. Sie kennen ihn nur als ewigen Duodez-Fürsten („Fürst Feinfrost“), der sich sogar öffentlich angeekelt abwendet, wenn Irina ihre notorische „Geschwätzigkeit“ abzuspulen beginnt. Hier nicht.
Irina, die Frau, scheint vor dem Gatten geschützt durch den Lehrer, der sich für Frauen nicht interessiert. Obwohl sie dem Lehrer, der sich im Glanz des gelungenen Auftritts aalt, gelegentlich die Schau zu stehlen droht. Er, der womöglich noch weniger von Frauen wahrnimmt als „normale Männer“, sieht dieses Wenige dennoch häufig genauer. Ernsthafter. Soweit er es gebrauchen kann.
Er liest über den 17. Juni 1953, den er fast verschlafen hat. Dann über Brecht. Schließlich über Bloch. Er ist kein Memoirenschreiber, auch wenn er die Chance, Hinz & Kunz aus der zweiten Reihe aktiv zu erleben, profitabel nutzt. Wenn er sich auf solche Personen konzentriert, ist er am stärksten. Seine Methode ist faszinierend, weil sie einem diese ehrfurchteinflößenden „Riesen“ nahebringt, ohne eine gewisse respektvolle schützende Distanz niederzureißen. Seine Methode, sich auf Personen zu konzentrieren, besteht eigentlich darin, sich auf Eigenschaften zu konzentrieren, die nicht unbedingt für jedermann erkennbar sind. Eigenschaften, die ihm selbst zu eigen sind. Das allerdings sagt er nicht, das wäre (vermutlich) „läppisch“.
Solche Eigenschaften – zum Beispiel Brechts „Spieltrieb“ und Horkheimers „Boshaftigkeit“ (von der er seinerzeit mündlich und vollmundig erzählt hatte, beim Essen, selbstverständlich, im alten Exil-Treffpunkt in Lugano, selbstverständlich, ich glaube, er heißt TIVOLI, den er uns selbstverständlich vorführte wie ein stolzer Besitzer eines Panoptikums, der einem die Welt zeigen kann – wir waren damals jung) -, solche Eigenschaften, die er an sich kennt, erkennt er öffentlich an anderen, die er liebt oder – deswegen – haßt.
An denen auch kann er sie an-er-kennen. Indem er sie zum Zentrum macht und alles „Bekannte“, alles „öffentliche Eigentum“ um sie herum gruppiert, läßt er Personen wie Werk in einem neuen Licht erscheinen. Seinem Licht. Er schreibt, also, über sich. Es sind – auch oder vielleicht sogar vor allem – Stichworte, die er seinen eigenen Rezensenten nahelegt, damit sie ihrerseits ihn damit schmücken, ihn begreifen können. (Es gibt viele, die diese Inszenierung als „Eitelkeit“ mißverstehen; vermutlich wissen die nichts vom Zwang zum do it yourself, dem Exilierte und andere Außenseiter ausliefert sind.) Man liebt und haßt andere immer für die Eigenschaften, die man an sich selbst schätzt oder verachtet. Das bringt die Nähe, die gleichzeitig die einzige Chance ist, etwas zu begreifen, und eine ständige Gefährdung: verwechselt, eingemeindet, maßstabsgetreu gemacht zu werden. Es ist wohl auch die einzige Chance, Fremdheit zu erfahren und auszuhalten. Die eigene und die der anderen. Voraussetzung für die unwiderrufliche Existenz auf Widerruf?
Manche wundern sich, später in der Kneipe ohne ihn, darüber, daß die „Dichter und Denker“ aus dem Exil in die DDR gingen. Daß sie, wenn sie „zurück“ wollten, den Teil Deutschlands vorzogen, der etwas „Neues“ zu probieren schien. Trotz Stalin – also trotz des Verrats nach innen namens Tschistka und trotz des Verrats nach außen namens Nichtangriffspakt. Manche haben offenbar das Gefühl, es habe sich damals alles so angefühlt wie heute. Denn denken kann man das nicht nennen, was sie auf solche Fragen bringt. Sonst wäre ihnen ein Gedanke wie der nicht fremd: daß Exilierte ein pointierteres Bedürfnis nach „Heimat“ haben als Leute, die mit der Kränkung des Ausgestoßenseins nie Bekanntschaft geschlossen haben.
Zum Beispiel das Bedürfnis, dort zu leben und zu arbeiten, wo die Anstrengungen, die Leiden und die Not einer Lebenserfahrung namens Exil gewürdigt werden. Wo sie als Teil der allgemeinen Geschichte geschätzt werden. Wo, also, die Chance besteht, sich seiner eigenen „persönlichen“ Geschichte zu versichern. Diese Atmosphäre der Sicherheit nach diesen unsicheren Jahren muß es in der frühen DDR gegeben haben. Denn im Westen war sie abwesend. Einiges, was in „normalen“ Ländern innerhalb der nationalen Grenzen aufeinanderprallt, wurde in Deutschland nach alter deutscher Weise fein säuberlich auseinandersortiert – nach hüben oder nach drüben. (Die westdeutsche traditionelle Linke ist an der Existenz der DDR gescheitert; die Lüneburger Gerichte brauchten nur noch auszufegen.)
Im Westen ist mit der Erfahrung Exil ebenso verfahren worden wie mit allem, was die zwölf Nazi-Jahre sonst ausgemacht hatte – sie sind alle verdrängt worden. Im selben Maß, wie in Westdeutschland ein schmerzhafter Mangel an Schamgefühl oder zumindest Entsetzen über die geschehenen und also: begangenen Ereignisse produziert worden ist (bis heute und erfolgreich!), im selben Maß hat in Westdeutschland die Arbeit Exil nicht wahrgenommen werden können. Die Exilierten sind ein zweites Mal um ihre Lebensgeschichte betrogen worden – zum ersten Mal, indem sie ins Exil (oder in den Tod) getrieben wurden; zum zweiten Mal in Form dieser westdeutschen fatalen „Selbstverständlichkeit“, mit der darüber hinweggegangen wurde. Dieser verklemmten Bagatellisierungen, dieser zynischen business as usual-Maske, hinter der sich niemand auch nur zu wundern scheint, plötzlich wieder zum Beispiel Juden gegenüberzustehen. Als hätte es nie eine Zeit gegeben, in der die eigene „Heimat“ als „judenfrei“ angepriesen werden konnte. Wie kann die „Heimat“ solcher Leute zur Wieder-Heimat der Exilierten werden?
Die Geschichte des Exils der alten und neuen Exilierten aus der DDR ist dann wiederum eine andere Geschichte. Oder vielleicht gar nicht so anders? Feststeht wohl, daß sie hier im Westen kaum die Heimat finden, die sie im Sinn haben, wenn sie das Bedürfnis nach Heimat verspüren.
„Hier, ich zeige Ihnen jetzt mal ein Foto, und dann sagen Sie mal als Frau, was Sie davon halten.“ Als Frau? Ich soll das Alter einer alten Dame schätzen. Es handelt sich um die Mutter seines Freundes Glubrecht. Who ever he is. Er strahlt, als ich mich über siebzig nicht vorwage. Sie ist neunzig. Oder einundneunzig.
„Und holen Sie uns doch ein bißchen Wurst, Lilo, die wird doch jetzt wohl da sein!“ Doch, er hat seine Weisen, mich „als Frau“ wahrzunehmen. Er versucht mit verschiedenen Taktiken herauszufinden, was für eine Frau er da neben sich hat. „Woher kommt denn ‚Pieke‘? Daran kann man ja gar nichts erkennen…“ Sehen Sie, sage ich, das gefällt mir ja gerade daran.
Weiter. „Schreiben Sie denn auch mal ‚was Größeres‘?“
Ja, antworte ich folgsam, ich habe da die Idee, Essays um das Thema „Exil“ herum zu schreiben. Ein paar davon sind fertig. Der über die „Deutsch-amerikanische Fremdheit“ zum Beispiel. Den hat er natürlich nicht gelesen. Aber das Thema erregt seine Neugier. Ja, so.
Er bietet mir dann der Reihe nach immer wieder Frauen an. Zum Beispiel Stefan Schütz. Den er für sehr begabt hält. Aber ein Stück hat der geschrieben, das ist vollkommen gescheitert, UNTERNEHMEN CRESSIDA oder so. Da habe er dem armen gebeutelten Schütz sagen müssen: „Schütz, Sie hätten einfach nur einen Satz schreiben sollen: Ich wär so gerne eine Frau, wau-wau!“ Und lacht.
Er riecht – weil er als der homo ludens, der Brecht war, einen ausgeprägten Sinn dafür hat, mit welchen Inszenierungen man Leute beeindruckt – sofort, daß er mich allemal eher mit den Frauen beeindrucken kann, die seinen Weg säumen durften. Oder, manchmal, deren Weg er säumen durfte. Schülerinnen wie Christa Wolf und Irmtraut Morgner, die bei ihm Examen gemacht haben. Und eine, die bei ihm promoviert, sei dabei, die Kracauer-Edition bei Suhrkamp auseinanderzunehmen; die sei nämlich ganz ganz schlampig. Bei Moravia assoziiert er Dacia Maraini. Gewöhnlich geschieht das umgekehrt.
Ich sage, als er von ihr schwärmt, „wir“ holen die im Herbst. Wer ist wir? Der ROT-BUCH-Verlag, der sie publiziert, und das Lesbenarchiv, dessen sezione italiana ihre Werke zusammenstellt. Kein Wimpernzucken beim Wort Lesben. Selbstverständlich überhört er interessiert sämtliche Implikationen. „Ihr habt ja im Katalog ein Foto von der Maraini, da sieht sie sehr schön aus.“
Ihr. Sein Ihr signalisiert, ohne identifizierbar zu sein, er hat mein Wir akzeptiert und in die ihm erträgliche Form gebracht. In die der ungefährlichen Professionalität. Wir/Ihr Ihr. bedeutet nunmehr offiziell: der ROTBUCH-Verlag, für den ich arbeite; nicht das Lesbenarchiv. Wir verstehen uns.
Vielleicht nur deshalb, weil auch mir seine Spielfreude nicht fremd ist, mit der er heute genießen kann, in Zentren des Prestiges, aus denen einer wie er prinzipiell ausgeschlossen ist, ein- und auszugehen. Diese boshafte Verspieltheit – die gleichzeitig ernst ist und ihn verletzbar, weiterhin kränkbar hält – mit der er sich „von Dohnany persönlich“ dazu einladen läßt, das Prestige eines städtischen Forschungsprojekts mit seinem Namen zu bebildern. Feixend, weil nur er wirklich auskosten kann, was für einen Gärtner er da abgeben wird, dieser bockige Außenseiter auf Widerruf.
© 1984.06. Pieke Biermann
[1] Siehe: Mayer war mein Tor zur Welt, Gespräch mit Pieke Biermann in: Der unbequeme Aufklärer – Gespräche über Hans Mayer, herausgegeben mit einer Einleitung von Heinrich Bleicher, Mössingen-Talheim 2022, S. 25-38.